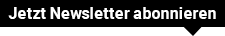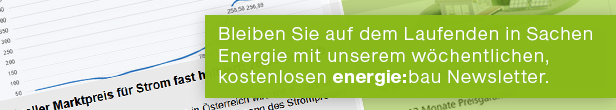Um zu demonstrieren, dass automatisierte Systeme praxistauglich sind, haben Forschende der Schweizer Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa im modularen Forschungsgebäude NEST untersucht, inwiefern ein bewohntes Gebäude verschiedene flexible Nachfragekriterien unter einem Dach vereinen kann. Im Fokus standen Reduktion der CO2-Emissionen, Flexibilität der Energienachfrage sowie Komfort der Bewohner. Mittels eines prädiktiven Kontrollalgorithmus gelang es, das Energiemanagement zu optimieren. Strom wurde dabei vom Netz bevorzugt dann bezogen, wenn er aus erneuerbaren Quellen verfügbar war.
Das System konnte einerseits den CO2-Ausstoß des Gebäudes um mehr als 10 Prozent senken, andererseits war das Gebäude in der Lage, vorausschauend zu kommunizieren, wann es wieviel Strom vom Netz beziehen beziehungsweise einspeisen kann. Das Experiment konnte zeigen, dass die flexible Verfügbarkeit erneuerbarer Energien nicht a priori ein Problem darstelle, so die Empa. Allerdings seien verlässliche Angaben zur Nachfrage und eine vorausschauende Planung essenziell – zwei Aufgaben, die ein selbstlernender Algorithmus besser und konsistenter bewältigen kann, als ein Mensch. (cst)