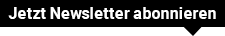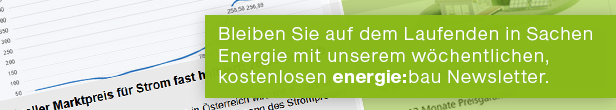Die Zunahme des Individualverkehrs, sprich: der privaten PKW, führt in Wien, Berlin oder Rom gleichermaßen zu immer größeren Staus – und immer restriktiveren Maßnahmen der Kommunen. Im Fokus steht fast immer der Ausbau der Radwege.
Sichtbare Vorzugsrouten für Radler
Zum Beispiel plant Zürich: ein durchgehendes Velovorzugsroutennetz und neue Velostandards. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und das Tiefbauamt der Stadt Zürich schreiben: „Umgesetzt werden die Vorgaben des Volkswillen mit einem durchgehenden, sichtbaren und attraktiven Velovorzugsroutennetz. Neue Velostandards sollen für Sicherheit und Komfort sorgen: Hauptrouten neu 2,2 m breit, Velovorzugsrouten 2,5 m breit. Velostreifen unter 1,25 m nicht mehr vorgesehen. Mindestabstand zu Parkplätzen 0,75 m."
Weitere Beispiele aus europäischen Hauptstädten:
Kopenhagen (Dänemark): Gilt als weltweites Vorbild. Die Strategie setzt auf flächendeckende, baulich getrennte Radwege von hoher Qualität, Fahrradbrücken und intelligente Ampelsysteme (grüne Welle für Radfahrer). Der Fokus liegt auf Sicherheit und Komfort, um das Radfahren zum bevorzugten Alltagsverkehrsmittel zu machen. Parkflächen für Autos wurden konsequent zugunsten von Radwegen und Fahrradparkplätzen umgenutzt.
Amsterdam (Niederlande): Ähnlich wie Kopenhagen setzt Amsterdam auf eine extrem dichte und hochwertige Radinfrastruktur mit breiten Radwegen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Management des riesigen Fahrradaufkommens (insbesondere an Bahnhöfen mit riesigen Fahrradparkhäusern) und der Integration von Lastenrädern.
Paris (Frankreich): Unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat Paris eine radikale Transformation durchgemacht. Die Strategie "Plan Vélo" zielt darauf ab, Autos aus der Stadt zu drängen. Dies geschieht durch den massiven Bau von Hunderte Kilometern neuen Radwegen (oft auf ehemaligen Fahrspuren oder Parkflächen, z.B. Rue de Rivoli), die Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs und die Umgestaltung ganzer Quartiere zur Verkehrsberuhigung. Das Ziel ist eine "15-Minuten-Stadt", in der alle wichtigen Ziele mit dem Fahrrad erreichbar sind.
London (Vereinigtes Königreich): London setzt auf ein ambitioniertes Programm von "Cycle Superhighways" (breite, geschützte Hauptrouten) und "Quietways" (verkehrsarme Routen durch Wohngebiete). Das "Mini-Hollands"-Programm in einzelnen Aussenbezirken zeigt, wie ganze Quartiere fahrradfreundlich umgestaltet werden können. Die Strategie ist Teil des umfassenderen "Mayor's Transport Strategy", das 80 % aller Fahrten zu Fuss, mit dem Velo oder ÖV bis 2041 vorsieht.
Berlin (Deutschland): Berlin hat sich mit seinem Radverkehrsplan und dem Mobilitätsgesetz ehrgeizige Ziele gesetzt. Die Strategie umfasst den Ausbau eines engmaschigen Radverkehrsnetzes (über 2.300 km), die Definition attraktiver Qualitätsstandards für Radverkehrsanlagen, die Verbesserung von Abstellmöglichkeiten (z.B. ParkYourBike-Anlagen an ÖPNV-Knotenpunkten) und die Förderung der Kombination von Rad und ÖV. Auch Berlin strebt eine "Vision Zero" an und hat mit der infraVelo ein eigenes Unternehmen für den Infrastrukturausbau gegründet.
Doch es geht vielleicht auch anders:
Gondeln statt Radwege
Der Lehrstuhl „Production Engineering of E-Mobility Components“ (PEM) der RWTH Aachen hat im Forschungsprojekt „upBUS“ mit der Fertigstellung eines Testaufbaus einen Meilenstein erreicht. Im Zuge der Entwicklung eines innovativen Verkehrsmittels, das einen autonom fahrenden Elektrobus mit einem Seilbahnsystem vereinen soll, beginnt auf dieser Basis bald die Erprobung eines Prototypen.
In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderten Gemeinschaftsvorhaben mit zwei weiteren Einrichtungen der RWTH Aachen und der Gemeinde Simmerath sollen die Vorteile der beiden miteinander kombinierten Verkehrsträger zur Geltung kommen und in einem intermodalen Verkehrskonzept vereint werden.
Seilbahn- und im Elektrobus-Betrieb
Während Seilbahnen mit kurzen Planungs- und Bauzeiten, niedrigen Investitions- und Betriebskosten sowie einem geringen Energieverbrauch punkten, besteht ihr Nachteil in der Bindung an feste Stationen. Autonome E-Busse hingegen bedienen engmaschige Netze, bleiben jedoch straßengebunden und tragen somit zur Bildung von Staus bei. „Als Seilbahn kann der ‚upBUS‘ Verkehrsengpässe oder landschaftlich schwierige Gebiete überbrücken und anschließend nahtlos als Bus weiterfahren, ohne dass die Passagiere umsteigen müssen“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker.
Die größte technische Herausforderung liegt im hohen Grad der Modularität.
Dies solle durch eine automatische An- und Abkopplung der Transportzellen an Chassis autonom agierender Straßenfahrzeuge gelingen, wobei die Seilbahnstationen als Verteilungszentren für engmaschige Busnetze dienen sollen. „Die größte technische Herausforderung liegt im hohen Grad der Modularität“, sagt Kampker, da das Vehikel aus insgesamt drei Hauptsystemen bestehen soll: einem autonomen Straßenfahrmodul, einer Fahrgastzelle und der Kopplungsschnittstelle „iTSI“ („intelligent Terrestrial System Interface“). iTSI ermögliche es, die Fahrgastzelle für den Straßenbetrieb an das Fahrmodul zu docken und die Transportzelle in der Seilbahnstation an das Seilgehänge zu übergeben.
Vorserienprototyp als Frachtvehikel i
Das Prozedere werde im August 2025 mit Hilfe eines sogenannten Primotypen erstmals erprobt. Das semi-autonome 48-Volt-Niederspannungs-Elektrofahrzeug nutze eine Stereo-Kamera sowie LiDAR-Sensoren zur Navigation und beinhalte einen Hebemechanismus sowie eine Weiterentwicklung der Kopplungsschnittstelle iTSI zur einfachen und sicheren Übertragung der Buskabine. Zum Ende des Projekts soll ein Vorserienprototyp als Frachtfahrzeug aufgebaut und im Feld getestet werden. Ein weiterer zur Beförderung von Personen soll indes digital entwickelt werden. Die entsprechende Kabine soll bis zu zehn Passagiere transportieren können und über sämtliche Eigenschaften eines klassischen ÖPNV-Fahrzeugs mit Blick auf Bestuhlung, barrierefreien Einstieg, Infotainment-System und Türschließautomatik verfügen.
Jährlicher 3,2-Milliarden-Euro-Verlust durch Stau
Hintergrund für das Projekt sind die in zahlreichen Städten überlasteten Verkehrsnetze. Allein im Jahr 2023 hatte im bundesweiten Durchschnitt jeder Pendler 40 Stunden lang im Stau gestanden. Das entspricht einem finanziellen Verlust von rund 3,2 Milliarden Euro. In ganz Europa werden darüber hinaus 60 Prozent der vom Straßenverkehr erzeugten Kohlenstoffdioxid-Emissionen dem sogenannten motorisierten Individualverkehr zugeordnet. Ein ÖPNV-Angebot mit „upBUS“-Fahrzeugen solle zu einer nachhaltigen und kostengünstigen Gestaltung des Personenverkehrs beitragen.
Weitere Informationen zum Projekt sind >> hier zu finden.