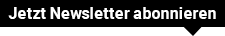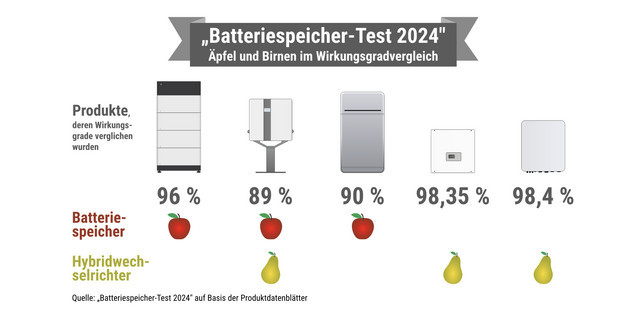Manche Sachen kann man nicht sinnvoll simulieren. Zum Beispiel das Verhalten von Eigenheimbesitzern. Der Mensch ist jeweils eigen, geht frühmorgens außer Haus, kommt nach der Arbeit abends zurück und kocht sich ein Spiegelei. Die Homeworkerin bleibt zuhause und lädt ihr Elektroauto während des Tages. Der Pensionist spart wo er kann, heizt aber mit Heizstrahlern den ganzen Winter über.
Simulation mit zu vielen Fragezeichen
Wer soll das simulieren? Langzeiturlaube, Wärmepumpen, Bügeleisen, Saunaöfen, Kinderwäsche, Riesenbildschirme, Klimageräte und Infrarotpanelle werden von unterschiedlichen Benutzer*innen zu unterschiedlichen Zeiten verwendet. All das ändert sich auch noch permanent.
Was heute gilt ist in fünf Jahren schon perdu: Kinder kommen im Haushalt dazu, irgendwo stirbt einer, das alte Auto wird durch ein elektrisches neues ersetzt. Das Haus wird verkauft, neue Nutzer*innen ziehen ein, alles beginnt wieder von vorn.
Alles ändert sich laufend, nix is fix
Und parallel dazu entwickelt die Industrie laufend neue, bessere, kleinere, automatischere Dinge, die dem Kraftwerk daheim nützen - oder selbiges belasten: Vernetzte Küchengeräte, schlaue Wärmepumpen, pfiffige Steuerungen.
Um nun zu entscheiden, welche Größe ein Stromspeicher haben sollte, müssten alle diese Imponderabilien irgendwie mitgedacht werden. Geht das? Nein.
Was aber als sicher – und bleibend – angenommen werden kann:
- Die Welt wird immer elektrischer (E-Autos, E-Heizungen, E-Rasenmäher ....)
- Es gibt zu viel Strom zur falschen Zeit
- Das Einspeisen ins Netz wird zunehmend eher bestraft als bezahlt
- Wer das Stromnetz nach seinen/ihren Regeln nutzen kann, profitiert
Alles das spricht für Stromspeicher.
Da trifft es sich gut, dass die Akkus immer billiger werden.
Stromspeicher eine Zukunftsbank
Daher ist ein möglichst großer Stromspeicher eine Zukunftsbank: Wer Elektrizität flexibel nutzen kann, zahlt weniger beim Energie-Einkauf und bekommt mehr für den gelieferten Strom. Denn die dynamischen Stromtarife mit stündlich wechselnden Werten können (automatisiert) genutzt werden. Derartiges entlastet die Stromnetze - weshalb es eben diese Tarifstrukturen gibt.
Fazit: In der Größe liegt die Kraft
Je größer der Akku im Einfamilienhaus, je fetter die Batterien im Supermarkt, in der Lackiererei oder beim Bäcker ausfallen, umso schneller werden sie sich amortisieren und zu Einsparungen führen. Jahrelang. Jahrzehntelang.
Land NÖ rät zu Minispeichern
Warum aber will uns zum Beispiel das Land Niederösterreich in Gestalt der dortigen Energie-Agentur einreden, man möge nur kleine Speicher einbauen?
Auf deren Webseite ist zu lesen:
„Bei der Dimensionierung von Stromspeichern ist darauf zu achten, dass die Speicherkapazität optimal genutzt wird. Zu große Speicher sind unwirtschaftlich. Zu kleine Speicher können im Bedarfsfall nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellen.
Faustformel: 1 : 1 : 1 (maximal 1 : 1 : 1,5)
Stehen der jährliche Strombedarf (in kWh/a), die Leistung (in kWp) der PV-Anlage und die (Netto-)Speicherkapazität (kWh) im Verhältnis 1:1:1, dann können rund 60 % des erzeugten Stroms von der eigenen PV-Anlage direkt verbraucht werden.
Beispiel für ein Einfamilienhaus: Bei einem Gebäude mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 kWh und einer PV-Anlage mit einer Leistung von 4 kWp ergibt sich eine optimale Speichergröße von 4 (max. 6) kWh Nettospeicherkapazität.“
Das ist einfach gesagt: Nonsens. Wer den Kauf eines derart kleinen Stromspeichers in Erwägung zieht (was kaum noch jemand tut) könnte getrost darauf verzichten. Die Anschaffung ist relativ gesehen viel zu teuer.
Aber warum gibt die landeseigene Energie-Beratung einen derartigen Ratschlag?
Die Antwort ist einfach: Das Land Niederösterreich würde sehr viel Geld verlieren, wenn sich sehr viele Private und Gewerbler größere Speicher kauften. Als 51%-Eigentümerin der EVN bekam die Landesregierung für 2023 beispielsweise 105 Millionen Euro an Dividenden überwiesen. Kein Wunder, dass man den Bürgerinnen und Bürgern zuruft: „Kauft kleine Speicher".
Wir aber sagen euch: „Kauft große Speicher!"
(hst)