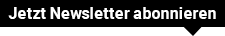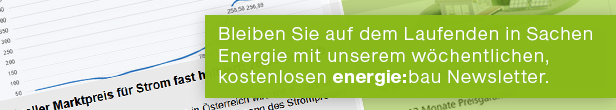Die stetig wachsende Bedeutung von Energieeffizienz und Wohngesundheit im Gebäudebereich hat in den vergangenen Jahren zu einer intensiven Auseinandersetzung mit geeigneten Baumaterialien geführt. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Wahl der Dämmstoffe.
Hier eine Übersicht von Christian Schaar, Geschäftsführer der S2 GmbH (s2-architektur.com) mit Erfahrungen aus der Arbeit mit diesen Materialien:
Während konventionelle Wärmeisolierungen wie Mineralwolle oder Styropor lange Zeit den Markt dominierten, rücken nun natürliche Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen stärker in den Fokus. Vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn die Anforderungen an den Wärmeschutz besonders hoch sind, zeigen diese Baustoffe ihre Stärken. Doch die Möglichkeiten ökologischer Dämmungen ist groß. Die richtige Wahl ist daher ebenso entscheidend wie die korrekte Verarbeitung, um Probleme wie Schimmelbildung zu vermeiden.
Feuchtigkeit und Kälte: Eine Herausforderung im Bauwesen
Kälte und Feuchtigkeit stellen im Bauwesen eine erhebliche Herausforderung dar und erhöhen in den Wintermonaten das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. Durchlässigkeit in der Gebäudehülle ermöglichen das Eindringen von feuchter Luft, Regen, Schnee oder Sickerwasser von außen, während Wohnprozesse wie Kochen oder Waschen zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im Innenraum führen.
Kondensiert diese Feuchtigkeit an kalten Bauteilen, bildet sich Schimmel, der nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann, wie Allergien oder Atemwegserkrankungen. Wärmebrücken, unzureichende Dämmung und eine mangelnde Luftdichtheit begünstigen diese Prozesse. Insbesondere bei der Sanierung älterer Gebäude, die häufig mit Feuchtigkeitsproblemen zu kämpfen haben, ist eine fachgerechte Dämmung und Abdichtung unerlässlich.
Natürliche Dämmstoffe im Vergleich zu konventionellen Materialien
Die Wahl eines geeigneten Dämmstoffes ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung einer Innendämmung und die Vermeidung von feuchtigkeitsbedingten Schäden. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfasern, Hanf, Schafwolle und Zellulose zeichnen sich durch ihre hohe Diffusionsoffenheit aus. Ihre Fähigkeit, große Mengen an Wasserdampf aufzunehmen und wieder abzugeben, minimiert nicht nur das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung, sondern sorgt auch für ein ausgeglichenes Raumklima.
Ihre klimafreundliche Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen, ihre gute Ökobilanz sowie ihre kompostierbaren Eigenschaften machen sie zu einer attraktiven Alternative für umweltbewusste Bauherren und Architekten. Zwar weisen synthetische Dämmstoffe wie PUR-Hartschäume eine gute Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit auf, jedoch sind sie in der Herstellung energieintensiv und belasten die Umwelt durch hohe CO2-Emissionen.
Ökologische Dämmstoffe im Detail
1. Holzfaser
Holzfaserdämmstoffe, hergestellt aus recycelten Holzabfällen, zeichnen sich durch eine hervorragende Wärmedämmung aus. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,037 bis 0,055 Watt pro Meter und Kelvin (W/mK) zählen sie zu den effizientesten natürlichen Dämmstoffen. Sie kommen als Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung am Dach, in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) und hinterlüfteten Fassaden sowie zur Dämmung von Wänden, Decken und Böden in Innenräumen zum Einsatz. Druckfeste Holzfaserplatten eignen sich zudem als Trittschalldämmung unter Böden.
 Holzfaserdämmplatten werden aus recycelten Holzabfällen gepresst. Foto: Mario Hoesel – stock.adobe.com.
Holzfaserdämmplatten werden aus recycelten Holzabfällen gepresst. Foto: Mario Hoesel – stock.adobe.com.
2. Hanf
Hanfdämmstoffe besitzen eine hohe Flexibilität. Sie sind in Form von Matten, Rollen, Schüttungen und Platten erhältlich und lassen sich somit an nahezu jede Bauform anpassen. Während Matten und Rollen besonders für die Dämmung von Wänden und Dach geeignet sind, finden Schüttungen und Platten vor allem im Fußboden- und Deckenbereich Anwendung. Stopfhanf wiederum eignet sich zum Auffüllen von Hohlräumen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,039 bis 0,047 W/mK steht Hanf herkömmlichen Materialien wie Styropor oder Glaswolle in nichts nach.
Um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen, müssen unbehandelte Hanfprodukte mit Soda-Lauge, Borsalz oder Amoniumphosphat imprägniert werden. Dadurch lassen sie sich gemäß DIN 4102-1 Norm bzw. EN 13501-1 Norm der Brandklasse B2 bzw. E zuordnen und gelten als normal entflammbar. Für die Außendämmung von Gebäuden ist Hanf aufgrund seiner geringeren Brandschutzklasse weniger geeignet.
3. Zellulose
Zellulose besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Altpapier und hat eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,035 und 0,040 W/mK. Sie wird vorwiegend als lose Einblasdämmung oder Schüttung in Boden-, Dach- und Wandbereichen eingesetzt. Die Flocken werden hierbei in Hohlräume eingebracht und stark verdichtet, wodurch eine homogene und lückenlose Dämmung entsteht. Besonders häufig wird sie in der Zwischensparrendämmung von Dachschrägen verwendet.
Ein großer Vorteil von Zellulose ist ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schimmelpilzbefall. Darüber hinaus kann sie auch die umliegende Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schimmel schützen. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich Zellulose besonders für den Einsatz in Innenräumen und nicht begehbaren Dachböden. In Holzrahmenbauten kann sie zudem für die Fassadendämmung verwendet werden, indem beidseitig Werkstoffplatten auf die Konstruktion aufgebracht werden.
4. Kalziumsilikatplatten
Hergestellt aus einem Gemisch von Kalk, Silikat und Zellulose, bieten Kalziumsilikatplatten eine vielseitige Lösung im Bereich der Wärmedämmung. Ihre poröse Struktur ermöglicht eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, ohne dass die Atmungsaktivität beeinträchtigt wird. Gleichzeitig sind sie wasserabweisend und sehr feuerbeständig. Kalziumsilikatplatten finden in verschiedenen Bereichen Anwendung, beispielsweise bei der Auskleidung von Kabelschächten. Ihre Wärmeleitfähigkeit liegt zwischen 0,050 und 0,070 W/mK. Aufgrund ihrer alkalischen Beschaffenheit bieten sie einen wirksamen Schutz gegen Schimmelbildung zwischen Dämmplatte und Wand.
5. Weitere Dämmstoffe
Auch Schafwolle, Flachs, Kork und Schilf zeichnen sich durch eine Vielzahl positiver Dämmeigenschaften aus. Schafwolle kann bis zu 33 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Flachs ist sehr formstabil und behält seine Dämmwirkung über lange Zeiträume bei, ohne sich zu setzen oder zu verformen. Kork ist leicht und flexibel, was die Verarbeitung erleichtert und ihn vielseitig einsetzbar macht.
Schilf ist von Natur aus resistent gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Schimmel, wodurch es langlebig und wartungsfreundlich ist. Während Schafwolle in Form von Matten, Vliesen oder Stopfwolle zum Einsatz kommt, sind Flachs, Kork und Schilf als Dämmplatten oder -matten erhältlich.
Erfolgreiche Dämmung mit natürlichen Materialien
Die fachgerechte Verarbeitung natürlicher Dämmstoffe ist entscheidend für deren optimale Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist unerlässlich, um Schäden zu vermeiden und die energieeffizienten Vorteile voll auszuschöpfen.
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:
• Die Bausubstanz muss trocken sein, um Schimmelbildung zu verhindern.
• Wärmebrücken sind zu vermeiden, indem die Dämmung lückenlos und vollständig angebracht wird, speziell in kritischen Bereichen wie Fensteranschlüssen und Heizkörpernischen.
• Zudem sollte die Fassade einen intakten Schlagregenschutz aufweisen.
• Alle verwendeten Materialien und Systeme müssen optimal aufeinander abgestimmt sein.
• Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Schutzkleidung und Atemschutzmasken erforderlich.
• Die Dämmstoffe sollten trocken gelagert und verarbeitet werden, um ihre Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
• Scharfe Werkzeuge gewährleisten saubere Schnitte und verhindern eine Beschädigung der Fasern.
+++
Über den Autor
Christian Schaar ist Geschäftsführer der S2 GmbH (s2-architektur.com). Seine baubiologischen Kenntnisse erlangte er durch den täglichen Umgang mit Problemen der Baubiologie in verschiedenen Unternehmen des ökologischen Holzbaus. Als Geschäftsführer eines Planungsbüros, dessen Schwerpunkt ebenfalls der ökologische Holzbau ist, wird er bei Neubauprojekten und Sanierungen regelmäßig mit baubiologischen Fragestellungen konfrontiert und als Experte auf diesem Gebiet konsultiert.